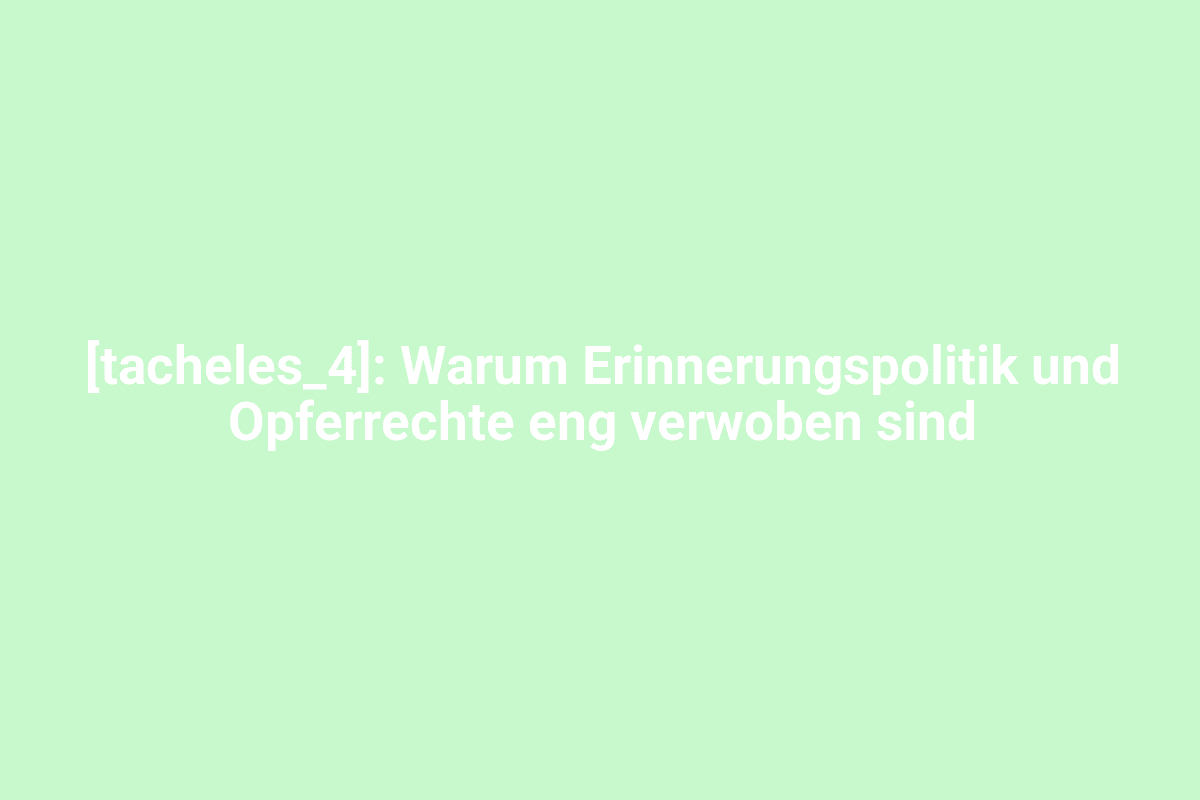10. September 2025
10. September 2025
Beim Gedenken des rassistischen Anschlags von Hanau standen besonders die Todesopfer im Vordergrund.
(Quelle: KA)
In Gesellschaften nach politischer Gewalt, Terror oder autoritärer Herrschaft war Erinnerung historisch ein integraler Bestandteil umfassender Gerechtigkeitsprozesse. In der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit rechter und rassistischer Gewalt in Deutschland hingegen wird Erinnerung zunehmend zum Ausgangspunkt: Sie deckt Leerstellen auf, schafft Sichtbarkeit und bringt – getragen von Betroffenen selbst – Forderungen nach Anerkennung, Aufklärung und Reparation in die Öffentlichkeit.
Anna Warda leitet das Modellprojekt „Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden“ bei der Amadeu Antonio Stiftung. Das von der Bundesbeauftragten für Antirassismus geförderte Projekt richtet sich an Gedenkinitiativen Überlebender und Hinterbliebener rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Anschläge – von Solingen und Rostock-Lichtenhagen über die NSU-Morde bis hin zu Halle und Hanau. Die Initiativen werden in ihrem Bemühen um Gedenken und die Anerkennung sowie Aufklärung der Taten unterstützt.
Davor arbeitete sie über 14 Jahre für Gunter Demnig und das europäische Kunst-Denkmal STOLPERSTEINE. Sie baute die zugehörige Stiftung – Spuren – Gunter Demnig mit auf und fungierte bis 2023 als Kuratoriumsmitglied.
Anna Warda hat Literaturwissenschaften und Geschichte an der Universität Potsdam studiert und promoviert an der Universität Potsdam und am Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) Potsdam über die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR im Globalen Süden.
Izabela Tiberiade ist die Tochter von Romeo Tiberiade und Iona Miclescu, Überlebende des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992, und Enkelin von Holocaust-Überlebenden. Dreißig Jahre nach den Pogromen wird sie das erste Mal nach Rostock eingeladen und darf bei der Gedenkfeier sprechen. Lange Jahre blieb die Perspektive der von den Pogromen betroffenen Roma* unbekannt. Die Betroffenen organisierten sich selbst in Craiova (Rumänien) und konnten sich durch den Kontakt zu einem Forschungsvorhaben Gehör verschaffen. Dreißig Jahre blieben Sichtbarkeit, Unterstützung und Anerkennung aus.
Dass Betroffene sich ihre Sichtbarkeit einfordern müssen, ist symptomatisch für die Erinnerung an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt. Nach dem Anschlag in Hanau haben sich manche Diskurse geändert – weg von einem Täternarrativ, hin zu den Betroffenen und der Benennung von Rassismus als Tatmotiv – jedoch weist die Auseinandersetzung mit diesen Formen von Gewalt bis heute eklatante Lücken auf. Bislang gibt es nicht mal eine systematische Übersicht über die Gedenkformen an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt nach 1945. Im Rahmen des Modellprojekts Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden gibt es erste Recherchen: Demnach existieren rund 150 erinnerungspolitische Zeichen im öffentlichen Raum, die auf zivilgesellschaftliche Initiativen zurückgehen, sowie 92 offizielle Gedenkzeichen – etwa durch Gemeinden, Kommunen oder Bundesländer. Insgesamt wird an 132 der bislang 221 dokumentierten Todesopfer rechter Gewalt öffentlich erinnert. Das bedeutet zugleich, dass es für 89 Fälle bislang keine sichtbare Form der Erinnerung gibt. An wen erinnert wird und an wen nicht, ist keine Frage des Zufalls, sondern Ausdruck blinder Flecken.
Erinnerung aus Betroffenenperspektive als Gegenwartsaufgabe
Dabei ist Erinnerungspolitik gerade angesichts zunehmender rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ein zentrales Instrument zur Stärkung demokratischer Strukturen. Wenn sie diesem Anspruch gerecht werden will, muss sie radikal aus der Perspektive der Betroffenen denken lassen. Denn wer betroffen war – von Gewalt, Ausgrenzung, Stigmatisierung oder Ignoranz – hat nicht nur das Recht, gehört zu werden. Er oder sie hat laut UN-Sonderberichterstatter*in für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung auch ein Anrecht darauf, dass diese Erfahrungen sichtbar gemacht, gesellschaftlich anerkannt und institutionell ernst genommen werden.
Erinnerung, die die Perspektive der Betroffenen ignoriert oder marginalisiert, wird selbst zum Teil des Problems. Sie verschleiert, statt aufzuklären, stabilisiert bestehende Machtverhältnisse, statt sie zu hinterfragen. Erst wenn der Blick konsequent von den Betroffenen ausgeführt wird, treten die Leerstellen zutage: nicht aufgeklärte Taten, institutionelles Versagen, fehlende Entschädigungen, ausbleibende juristische Anerkennung – all das sind Lücken im erinnerungspolitischen Gedächtnis, die gleichzeitig Ausdruck rechtlicher und politischer Versäumnisse sind.
Bestehende und erkämpfte Formen der Erinnerung fokussieren heute zunehmend nicht nur auf die Taten selbst, sondern auch auf die sozialen und politischen Strukturen, die solche Gewalt begünstigen oder begleiten: institutioneller und struktureller Rassismus, mangelnde Aufklärung, fehlende Repräsentation – Aspekte, die sich in der Folge oft in Täter-Opfer-Umkehr und sekundärer Viktimisierung manifestiert haben. Heute stehen häufig die Namen, Geschichten und Forderungen der Betroffenen im Zentrum. Diese erinnerungspolitischen Praktiken entstehen in der Mehrzahl nicht durch staatliche Initiative, sondern werden maßgeblich von Angehörigen, Überlebenden und zivilgesellschaftlichen Gruppen entwickelt und getragen. Sie verfolgen nicht nur das Ziel der historischen Dokumentation, sondern sind auch Ausdruck des Anspruchs auf gesellschaftliche Anerkennung, Gerechtigkeit und politische Konsequenzen. Der erinnerungspolitische Raum ist ein umkämpftes Feld gesellschaftlicher Aushandlungen um Sichtbarkeit, Deutungshoheit und Rechte.
Die Verschiebung vom symbolischen Gedenken hin zu einer politisierten, kontextsensiblen Erinnerung – zeigt sich deutlich in der Vielfalt konkreter und selbstbestimmter Erinnerungspraktiken. Denn was inhaltlich zunehmend die strukturellen Bedingungen rassistischer Gewalt thematisiert, schlägt sich auch in einer breiten Palette an Formen und Ausdrucksmitteln nieder.
Die Formen der Erinnerung an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt sind heute so vielfältig wie die Kontexte, in denen sie entstehen. Sie reichen von klassischen Gedenktafeln, Mahnmalen, Straßennamenänderungen, über Gedenktage, Schweigemärsche, Demonstrationen, Theaterstücke, Ausstellungen und Podcasts bis hin zu digitalen Formaten wie Hashtags, Webseiten oder Video-Installationen – selbst Graffiti oder Fußballtrikots werden zum Träger von Erinnerung. Diese breite Palette an Praktiken zeigt nicht nur die kreative Kraft zivilgesellschaftlicher Auseinandersetzung, sondern auch den Versuch, Erinnerung in unterschiedlichen sozialen Räumen und Generationen zu verankern. Dabei geht es nicht allein um die Taten selbst, sondern ebenso – und oft im Vordergrund – um die Menschen, die ihnen zum Opfer fielen. Ihre Namen, Geschichten und Gesichter werden sichtbar gemacht und damit dem Vergessen aktiv entzogen.
Bemerkenswert ist dabei, dass viele dieser Formen und Inhalte von Betroffenen, Angehörigen und solidarischen Initiativen selbst getragen werden. Gerade in den ersten Tagen nach den Anschlägen entstehen oft spontane Erinnerungspraktiken, die später – nach oft langwierigen Aushandlungen – zu dauerhaft sichtbaren Formen des Gedenkens werden. Diese selbstbestimmte, von unten entwickelte Erinnerungskultur stellt nicht nur die Gewalt, sondern auch ihre gesellschaftlichen Bedingungen und die Forderungen der Betroffenen in den Mittelpunkt. Die Arbeit der Betroffenen wirkt als sogenannter Memory Activism bezeichnet, der sich gegen symbolische Gesten stellt und eine gezielte Form des zivilgesellschaftlichen Erinnerns, bei dem Einzelpersonen oder Gruppen außerhalb staatlicher Kanäle in strategischer Absicht die öffentliche Erinnerung an die Vergangenheit aktiv verändern oder bewahren wollen. So entwickelt ihr Aktivismus eine transformative Kraft von „unten“, die in Gesellschaft und Politik hinein wirkt. Im Zuge der Arbeit der Betroffenen hat sich ein bundesweites Solidaritätsnetzwerk etabliert, in dem sich derzeit rund 25 selbstorganisierte Betroffeneninitiativen zusammengeschlossen haben. Es ist nicht nur Ort gegenseitiger Unterstützung, sondern auch Träger gemeinsamer Gedenk-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Einsatz für die eigenen Narrative und Formate des Erinnerns. Aus der inhaltlichen Auseinandersetzung und Praxis betroffenenbasierter Erinnerungskultur ergeben sich normative, politische und rechtliche Anschlussfragen, insbesondere im Hinblick auf Opferrechte, die bislang im erinnerungspolitischen und juristischen Diskurs weitgehend unbeachtet geblieben sind.
Erinnerung und Opferrechte
Während Betroffene Verantwortung übernehmen, Öffentlichkeit schaffen und Missstände benennen, bleibt die juristische und institutionelle Anerkennung ihrer Position häufig aus.
Betroffen haben juristisch verankerte Opferrechte – sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene – etwa auf Schutz, Aufklärung, Unterstützung, Entschädigung oder Beteiligung am Strafverfahren. Diese Rechte sind zentral, um Betroffenen nicht nur individuelle Unterstützung zu gewähren, sondern auch ihre Erfahrungen gesellschaftlich anzuerkennen. Genau hier beginnt der Zusammenhang zur Erinnerung: Gerade aus der Perspektive der Betroffenen wird deutlich, wie Erinnerung dazu beiträgt, diese Rechte einzufordern und im Zuge dessen institutionelles Versagen zu benennen, Fragen von Verantwortung in die Öffentlichkeit zu tragen und politische sowie juristische Handlungserfordernisse zu markieren.
Erinnerung als Gerechtigkeitsprozess: Transitional und Institutional Justice
Dabei deckt Erinnerung nicht nur bestehende Missstände auf, sondern formuliert zugleich konkrete Forderungen und Handlungsempfehlungen: nach Aufklärung, nach Entschädigung, nach struktureller Veränderung. Erinnerungsarbeit wird somit in Bezug auf rechte, rassistische und antisemitische Gewalt zu einem Instrument für Sichtbarkeit, Anerkennung und Einforderung von Rechten. Gerade in Fällen, in denen rassistische Morde von den Ermittlungsbehörden nicht als politisch motiviert anerkannt wurden, blieb Betroffenen der Zugang zu Entschädigung und rechtlicher Anerkennung lange verwehrt. Erst durch das Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen und der Betroffenen selbst kann Sichtbarkeit geschaffen und damit auch die rassistische Dimension der Tat öffentlich gemacht werden.
In Post-Konflikt-Gesellschaften – nach Krieg, Diktatur oder Massengewalt – war Erinnerung traditionell eingebettet in umfassende Gerechtigkeitsprozesse. Transitional-Justice-Mechanismen, welche in der Regel die Aufarbeitung von Unrecht nach Gewalt oder Diktatur hin zu einem demokratischen System begleiten, wie Wahrheitskommissionen, juristische Aufarbeitung, Reparationen und öffentliche Anerkennung, zielten darauf ab, Demokratie zu stabilisieren und Unrecht kollektiv aufzuarbeiten.
Im Feld der Erinnerung an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt zeigt sich jedoch eine Umkehrung dieser Dynamik: Erinnerung ist häufig nicht mehr Teil eines Gerechtigkeitsprozesses, sondern dessen Instrument, Ausgangspunkt oder Anstoß. Besonders aus Sicht der Betroffenen wird deutlich, dass erinnerungspolitisches Engagement heute dazu dient, juristische Aufarbeitung und Entschädigung überhaupt erst anzustoßen: Es ist kein symbolischer Akt, sondern Impuls für strukturelle Gerechtigkeit. An diesem Punkt greift das Konzept der Institutional Justice, welches erinnerungspolitische Initiativen und juristische Aufarbeitung nicht nur symbolisch, sondern strukturelle Verantwortung als notwendig sieht.
Erinnerung als Instrument für Rechte
Die Arbeit der Betroffeneninitiativen ist beeindruckend: Sie haben Erinnerung geschaffen, die Leerstellen sichtbar gemacht und gesellschaftliche Veränderung angestoßen. Diese Initiativen leisten eine ungeheure Transformation – obwohl dies eigentlich in den Aufgabenbereich demokratischer Institutionen gehört.
In Gesellschaften nach Gewalt oder Terror sollte Erinnerung Teil eines systematischen Gerechtigkeitsprozesses sein, wie ihn Transitional Justice vorsieht: Erinnerung, Wahrheit, Anerkennung, Reparation und institutionelle Verantwortung wären gleichwertig und miteinander verknüpft. Fehler, Versagen oder Ignoranz des Staates gegenüber Betroffenen wären transparent und bearbeitet – ohne, dass die Betroffenen dafür selbst kämpfen müssten.
Aktuell aber bleibt die Anerkennung von Betroffenen in Deutschland häufig aus: Sie müssen Sichtbarkeit, Rechte und Gerechtigkeit selbst einfordern. Derzeit fehlt in der Erinnerungskultur der Fokus auf strukturelle Verantwortung. Ein Schritt in diese Richtung könnte sein, die Reparationen als Verantwortung der Gesamtgesellschaft zu denken; wie der US-amerikanische Autor Ta-Nehisi Coates für den Umgang mit rassistischer Gewalt fordert: „Reparations — by which I mean the full acceptance of our collective biography and its consequences—is the price we must pay to see ourselves squarely.“
Bis Anerkennung, Entschädigung und strukturelle Konsequenzen gesichert sind, bleibt Erinnerung weniger Teil von Reparation als deren Anstoß. Aber die Praxis der Betroffenen zeigt, wie zentral Erinnerung als politisches Mittel im Kampf um Wahrheit, Rechte und Gerechtigkeit ist – und wie dringend demokratische Verantwortung dafür gestärkt werden muss.
*Mit einem erweiterten Fokus auf Anerkennung wird dieser Text im Dezember 2025 in der Broschüre „Opferrechte“ des Netzwerkes in Kooperation mit dem Projekt veröffentlicht werden.