25. October 2025
Die irren Fakten zur Rhein-Pipeline, die den Hambacher See bei Köln füllen soll
Im Rheinischen Revier, nur wenige Kilometer westlich von Köln, entsteht in den kommenden Jahrzehnten ein völlig neues Landschaftsbild. Wo heute noch der Braunkohletagebau Hambach klafft, soll ein riesiger See entstehen – so groß wie fast 5.000 Fußballfelder und über 300 Meter tief.
Doch dieses gigantische Projekt braucht viel Wasser. Sehr viel Wasser. Deshalb wird aktuell die sogenannte Rheinwassertransportleitung geplant – eine Art Lebensader aus dem Rhein, die ab 2030 Wasser in die Grube bringen soll. (Grafik: Neuland Hambach)
Wir zeigen, was dahintersteckt, wie der aktuelle Stand ist, und warum das Projekt nicht unumstritten ist.
Warum braucht der Tagebau Hambach eine Rheinleitung?
Seit Jahrzehnten wird im Tagebau Hambach Braunkohle abgebaut – eines der größten Grubenlöcher Europas. Ab 2029 ist damit Schluss. Doch was bleibt, ist eine riesige künstliche Landschaft mit einem enormen Volumen: Der geplante Hambacher See soll einmal rund 4,3 Milliarden Kubikmeter Wasser fassen – das ist mehr als doppelt so viel wie der Bodensee.
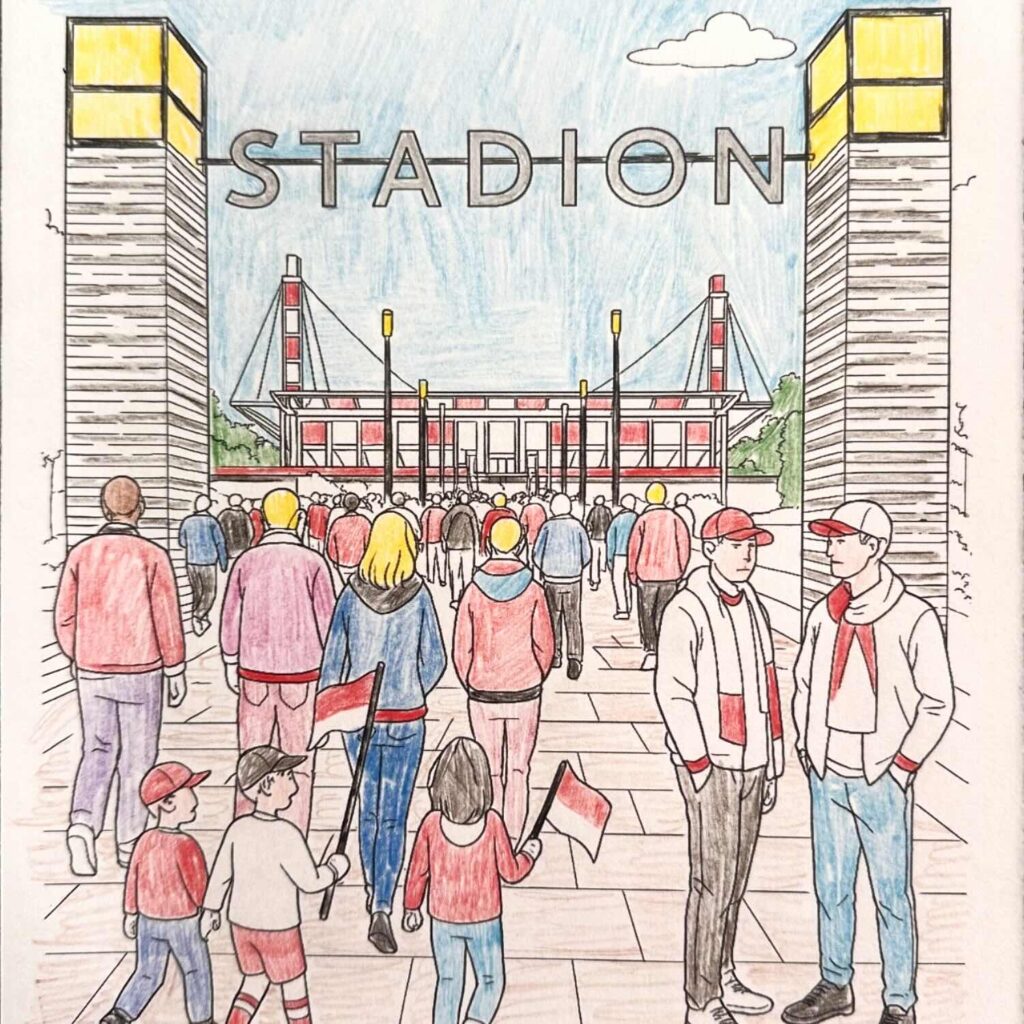
Es riesiges Freizeitgebiet könnte entstehen, geplant sind unter anderem Häfen für viele Boote – die Landschaft wäre eine andere.
Aus eigener Kraft, also durch aufsteigendes Grundwasser, würde die Grube mehrere Jahrhunderte brauchen, um sich zu füllen.
Deshalb will man Rheinwasser nutzen, um den See schneller vollzulaufen zu lassen – voraussichtlich in rund 40 Jahren. Gleichzeitig soll die Leitung Feuchtgebiete in der Region ökologisch mit Wasser versorgen.
Denn durch den Kohleabbau war der Grundwasserspiegel jahrelang künstlich abgesenkt worden – was nicht nur Bäume und Feuchtwiesen belastete, sondern auch viele Biotope. Die Leitung soll also den Strukturwandel im Revier nicht nur landschaftlich, sondern auch ökologisch stützen.
Wo verläuft die Rhein-Pipeline?
➡️ Die sogenannte Rheinwassertransportleitung (kurz: RWTL) beginnt bei Dormagen-Rheinfeld, etwa 20 Kilometer nördlich von Köln. Dort wird ein großes Entnahmebauwerk am Rhein errichtet, das künftig Wasser aus dem Fluss abschöpfen soll – bis zu 18.000 Liter pro Sekunde.
Über mehrere riesige Stahlrohre mit einem Durchmesser von 2,20 Metern fließt das Wasser zunächst rund 25 Kilometer weit bis nach Allrath (bei Grevenbroich). Dort wird es in zwei Richtungen verteilt: Eine Leitung führt weiter Richtung Tagebau Garzweiler, die andere nach Süden in Richtung Hambach.
➡️ Die sogenannte Hambach-Leitung ist rund 18 Kilometer lang und verläuft größtenteils unterirdisch – unter Feldern, Straßen und teils durch Landschaftsschutzgebiete. Sie endet am Rand des Tagebaus, wo ein Auslaufbauwerk das Wasser in das Restloch einleitet.
Gebaut werden sollen außerdem mehrere Pumpstationen, ein Verteilerbauwerk sowie Kontroll- und Wartungsschächte entlang der Trasse. Die Rohre selbst kommen per Schiff und Bahn in die Region – pro Stück rund 15 Tonnen schwer.
Aus dem Verliebt in Köln-Shop:
Wann geht es los – und wie lange dauert das?
Ziel ist es, die Pipeline bis 2030 fertigzustellen. Der Zeitplan ist ambitioniert – zumal der Kohleausstieg im Tagebau Hambach auf Ende 2029 vorgezogen wurde.
Die eigentliche Befüllung des Hambacher Sees wird Jahrzehnte dauern. Je nach Wetter, Rheinpegel und technischer Umsetzung rechnen Fachleute mit rund 40 Jahren, also bis etwa 2070. Danach soll die Leitung noch mehrere Jahrzehnte in Betrieb bleiben, um Verdunstungsverluste auszugleichen und den Grundwasserhaushalt zu stabilisieren.
➡️ Frühestens gegen Ende des Jahrhunderts könnte die Leitung zurückgebaut werden – oder dauerhaft weiterbetrieben, je nach Entwicklung.
Wer ist verantwortlich – und was wurde bisher beschlossen?
Trägerin des Projekts ist die RWE Power AG, die auch den Tagebau betreibt. Die übergeordnete Planung erfolgt durch die Bezirksregierung Köln – insbesondere im sogenannten Braunkohlenausschuss. Dort wurde Ende 2023 die Trasse der Pipeline offiziell in den Braunkohlenplan aufgenommen. Damit ist der Leitungskorridor raumordnerisch gesichert.
Für den Bau und Betrieb der Leitung ist eine Genehmigung nach dem Bundesberggesetz nötig – das sogenannte Betriebsplanverfahren. Zuständig ist die Bezirksregierung Arnsberg. Im Sommer und Herbst 2024 wurden die Unterlagen öffentlich ausgelegt, Bürger:innen und Umweltverbände konnten Einwendungen einreichen. Der Genehmigungsbescheid wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.
Zusätzlich braucht es eine wasserrechtliche Erlaubnis, denn die Entnahme aus dem Rhein ist genehmigungspflichtig. Auch hier läuft derzeit die Prüfung. Eine Besonderheit: Die erlaubte Entnahme hängt vom Rheinpegel ab – bei Niedrigwasser darf weniger oder gar kein Wasser entnommen werden, um Schifffahrt und Ökologie nicht zu gefährden.
Rheinwassertransportleitung: Umweltaspekte und Kritik
So gewaltig das Projekt ist – so groß sind auch die Diskussionen. Die Leitung bringt zweifellos Chancen: Sie hilft, die riesige Grube in einen nutzbaren See zu verwandeln, unterstützt den Wiederanstieg des Grundwassers und bewahrt bedrohte Feuchtgebiete vor dem Austrocknen. Doch Umweltverbände sehen auch Risiken.
Ein zentrales Thema ist die Wasserqualität. Der Rhein führt – trotz verbesserter Wasserreinhaltung – noch immer Spurenstoffe, Medikamentenrückstände und Mikroplastik mit sich. Wird dieses Wasser ungefiltert in den künftigen See eingeleitet, könnten sich diese Stoffe im Boden ablagern oder ins Grundwasser übergehen.
Vor allem die Lage der Entnahmestelle – direkt unterhalb des Chemparks Dormagen – sorgt für Kritik: Dort gelangen auch gereinigte Abwässer in den Fluss.
RWE betont, dass alle relevanten Wasserwerte geprüft wurden und keine Gefahr für Mensch oder Umwelt besteht. Umweltverbände wie der BUND fordern dennoch ein autonomes Monitoring direkt an der Entnahmestelle – sowie gegebenenfalls eine Filterung oder alternative Standorte.
Auch die Langfristfolgen sind umstritten: Was passiert, wenn die Leitung nach 2100 weiter nötig ist? Wer übernimmt dann Verantwortung und Kosten?
Eine Jahrhundertfrage für das Revier
Eines ist klar: Die Rheinwassertransportleitung ist eines der größten Infrastrukturprojekte in NRW seit Jahrzehnten. Sie verbindet Industriegeschichte mit Zukunftsvision, Ökologie mit Technik. Für viele Menschen im Rheinischen Revier ist sie ein Symbol – für das Ende der Braunkohle, für einen Neuanfang. Doch wie bei vielen Großprojekten gilt:
Nur wenn Transparenz, Vorsorge und Beteiligung ernst genommen werden, kann daraus wirklich eine Erfolgsgeschichte werden.
Verliebt in Köln
Hier den Artikel weiter lesen…