Quelle: CORRECTIV.Faktencheck!
Wie hat eine Wahlurne auszusehen? Wurde bei der Wahl getrickst? Und was unterscheidet eigentlich eine Hochrechnung von einer Umfrage? Alles legitime Fragen bei einer Wahl. Doch für Akteure im Bereich der Desinformation sind sie häufig dazu da, Misstrauen bei Wahlvorgängen zu säen und damit demokratische Prozesse in Frage zu stellen.
CORRECTIV.Faktencheck berichtet seit Jahren über Desinformations-Narrative und Falschmeldungen, die rund um Wahlen kursieren. Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 klären wir über gängige Falschbehauptungen auf.
Von der Umfrage zur Auszählung: Wo Desinformation ansetzt
So sicher wie die Wahlplakate an Straßenlaternen sind vor einer Wahl auch sie: Wahlumfragen. Forschungsinstitute wie Infratest Dimap veröffentlichen vor Wahlterminen in regelmäßigen Abständen Umfrageergebnisse, die die Stimmung in der Bevölkerung abbilden sollen.
Verschiedene Befragungen kommen zu teils unterschiedlichen Ergebnissen. Das kann an der Menge oder Auswahl der befragten Personen liegen, am Befragungszeitpunkt oder an der Fragestellung der Erhebung. Unterschiedliche Umfragewerte bedeuten deshalb nicht, dass eine der Befragungen falsch ist.
Stutzig machen sollten Umfragen, deren Zahlen deutlich von allen anderen abweichen. Vor der Bundestagswahl etwa verbreitete ein obskures US-„Institut“ im Januar 2025 eine Umfrage, nach der Alice Weidel die beliebteste Kanzlerkandidatin sei. Anfang Februar behauptete der X-Account „Prognos Umfragen“, die AfD liege vor der CDU in der Wählergunst. Und auch kurz nach der Wahl wurde mit einer auf Tiktok geteilten Grafik behauptet, 51 Prozent der Deutschen würden die AfD wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Alle diese Umfragen sind unseriös, die Zahlen mutmaßlich frei erfunden oder deren Herkunft und Grundlage völlig unklar.
Der Rat der deutschen Markt- und Sozialforschung weist auf Standards hin, an denen man seriöse Befragungen erkennt. Spätestens auf der Webseite der Umfrage-Urheber sollten demnach diese Informationen zur Verfügung stehen:
- Name des Instituts, das die Befragung durchgeführt hat
- Größe der Gruppe der Befragten
- Untersuchungszeitraum
- Methoden für die Stichprobe sowie für die Befragung (mündlich, schriftlich, telefonisch oder online Interviews)
- Wortlaut der Fragen
- Ob und falls ja, welche Gewichtungsverfahren angewandt wurden
Abgesehen davon lohnt sich oft auch die kritische Betrachtung von Grafiken. Sind die Balken oder Linien beispielsweise im Verhältnis zu den dargestellten Zahlen? Ist eine Quelle angegeben und falls ja, sind dort die gleichen Ergebnisse zu finden?
Die Seite Wahlrecht.de bildet für bundes- und landesweite Wahlen Umfrageergebnisse renommierter Institute ab, allerdings nicht für die Kommunalwahlen in NRW. Der WDR bezieht sich auf die Ergebnisse von Infratest Dimap. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa führte im Auftrag mehrerer Tageszeitungen eine Umfrage durch. Neben diesen landesweiten Umfragen gibt es auch welche auf Städte-Ebene, beispielsweise für Bonn oder Düsseldorf.
Briefwahl als beliebtes Ziel von Falschbehauptungen
Schon mit der Aussendung der Briefwahl-Stimmzettel kommt immer wieder die Frage auf, was es denn mit der abgeschnittenen Ecke am Stimmzettel auf sich hat. Die ist nicht – wie häufig behauptet wird – ein Zeichen dafür, dass der Stimmzettel ungültig ist, sondern hilft Menschen mit Sehbehinderung dabei, sie in eine Schablone einzulegen. Die abgeschnittene Ecke ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, für die NRW-Wahl in Paragraf 32 der Kommunalwahlordnung.
Die Aufforderung, den Stimmzettel zu unterschreiben, sollte man ignorieren. Diese richtete sich in der Vergangenheit häufig an AfD-Anhängerinnen und -Anhänger, wohl in der Hoffnung, dass sie damit ihre Stimme ungültig machen. Denn Zusätze oder Vorbehalte sind laut Paragraf 52 der Kommunalwahlordnung nicht zulässig. Außerdem sollen Stimmen geheim sein, wie im Kommunalwahlgesetz in Paragraf 25 steht. Wer jemanden über den Wahlvorgang so täuscht, dass dieser seinen Stimmzettel ungültig macht, könnte sich sogar der Wählertäuschung nach dem Strafgesetzbuch strafbar machen. Unterschrieben werden muss jedoch der Wahlschein, der bei der Briefwahl beigelegt wird.
Tendenziell nutzen AfD-Wählerinnen und -Wähler die Briefwahl eher selten – nicht zuletzt, weil die Partei selbst immer wieder davor warnt. Gleichzeitig muss das schlechte Abschneiden der Partei bei den Briefwählenden dann dafür herhalten, die Briefwahl infrage zu stellen – eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Noch weiter ging ein Fake, der uns vor der Bundestagswahl 2024 begegnet ist: Ein Video sollte damals zeigen, wie Briefwahl-Stimmen für die AfD geschreddert werden. Doch das Video war eine Fälschung und wohl Teil einer russischen Einflusskampagne.
Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Pannen bei der Briefwahl, so wurden etwa bei der Bundestagswahl in einzelnen Wahlkreisen Unterlagen mehrfach versandt. Fachleute schätzen uns gegenüber in der Vergangenheit aber auch bei Kommunalwahlen die Sicherheit der Briefwahl als „sehr hoch“ ein. Das Innenministerium NRW beschreibt die Sicherheitsmechanismen: So würden Briefwahlstimmen öffentlich und nach dem Mehraugenprinzip ausgezählt, Wahlleiter und Wahlausschüsse würden den Vorgang überprüfen.
Gerüchte und Falschmeldungen rund um Urnen, Wahlhelfer und Wahlbeobachter
Am Wahltag wird besonders genau auf Wahlurnen geblickt. Über die Frage, wie diese aussehen und gesichert sein müssen, gehen in Sozialen Netzwerken die Meinungen weit auseinander. Gesetzlich festgeschrieben ist folgendes: „Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen und verschließbar sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muss die Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als 2 cm sein darf”, heißt es dazu in Paragraf 36 der Wahlordnung für NRW. Ein Siegel oder Schloss braucht eine Wahlurne nicht.
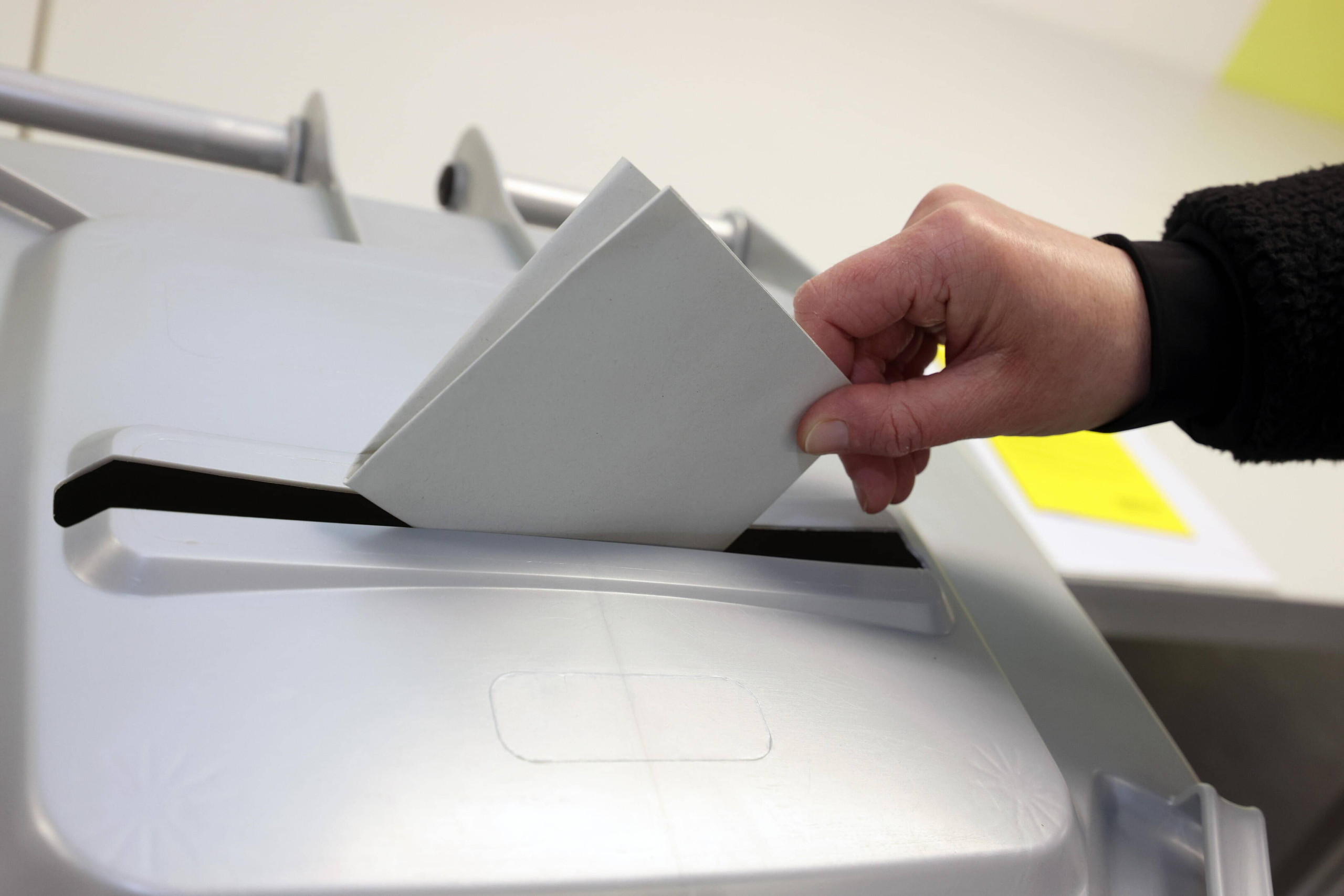
Auffällig laut ist beim Thema Wahlbeobachtung häufig der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Verein „Ein Prozent“. Er mobilisiert vor Wahlen Wahlbeobachter, um das Ergebnis dann infrage zu stellen. So hieß es nach der Landtagswahl in Thüringen seitens des Vereins etwa, ein Absperrband habe Wahlbeobachter ausgesperrt – tatsächlich wurde es gezogen, um Störungen bei der Stimmabgabe zu verhindern.
Über 100.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden wohl bei der Kommunalwahl in NRW im Einsatz sein. An Wahltagen ist aber nicht jeder Wahlhelfer, der sich online als solcher ausgibt. Häufig begegnen uns scherzhaft gemeinte Behauptungen, vermeintliche Wahlhelfer hätten Stimmzettel verschwinden lassen oder ungültig gemacht – der Hinweis auf Satire fehlt dabei häufig. Hinter anderen Falschmeldungen stecken alte Fotos oder Unstimmigkeiten in den eigenen Schilderungen.
Nach der Stimmabgabe: Prognosen richtig verstehen
Das Kreuz ist gemacht, der Stimmzettel eingeworfen, der Fernseher läuft und Punkt 18 Uhr sind die ersten Zahlen zu sehen. Diese ersten Statistiken waren zum Beispiel nach der Europawahl im Juni 2024 Gegenstand von Verwirrung. Personen verbreiteten ein Video auf Tiktok, in dem angezweifelt wurde, dass es bei Wahlen mit einem derart schnellen Ergebnis mit rechten Dingen zugehen könne. Auch nach der Bundestagswahl in diesem Jahr und der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen 2024 sahen wir Falschbehauptungen zu dem Thema.
Was stimmt: Um 18 Uhr am Wahltag gibt es noch keine Ergebnisse. Die ersten Zahlen, die seriöse Medien zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen, sind meist Prognosen – weder Hochrechnungen, noch endgültige Ergebnisse.
Bei den Wahlprognosen handelt es sich um eine spezielle Form der Umfrage. Während Wahlumfragen im Vorfeld einer Wahl das Stimmungsbild der Gesellschaft abbilden, werden für die Prognosen am Wahltag selbst die Wählerinnen und Wähler nach ihrer Stimme gefragt, wenn sie das Wahllokal verlassen. Die Frage ist also nicht hypothetisch: „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?“ sondern ganz konkret: „Wem haben Sie gerade Ihre Stimme gegeben?“
Wahlumfrage, Wahlprojektion und Wahlprognose
Wahlumfragen fangen die politische Stimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, indem Befragte darauf antworten: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“.
Wahlprojektionen beziehen zusätzlich längerfristige Einflüsse in ein Modell mit ein, wie etwa politische Grundüberzeugungen und Bindungen an Parteien, um auf das tatsächliche Wahlverhalten schließen zu können.
Wahlprognosen beruhen auf der Befragung von Wählerinnen und Wählern am Wahltag beim Verlassen des Wahllokals und werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale am Wahlabend veröffentlicht.
Wie jede Befragung sind auch Prognosen eine Annäherung an die tatsächlichen Ergebnisse. Die Forschungsgruppe Wahlen, die Prognosen und Hochrechnungen für das ZDF macht, erklärt ihre Methodik wie folgt: An zufällig ausgewählten Wahllokalen werden zufällig ausgewählte Wählerinnen und Wähler gebeten, einen Fragebogen schriftlich auszufüllen. Neben der Antwort auf die Frage, wen sie gerade gewählt haben, sollen die Teilnehmenden hier auch Angaben zu bestimmten soziostrukturellen Merkmalen, wie Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus machen. Anhand dieser Merkmale werden die Ergebnisse dann mit speziellen Modellen gewichtet.
Ein Beispiel, um diese Art der Prozesse zu illustrieren: In der Befragung geben alle Personen über einem bestimmten Alter an, Partei A zu wählen und alle unter einem bestimmten Alter Partei B. Durch das Zufallsprinzip sind in der Gruppe der Befragten aber viel mehr jüngere Personen als ältere. Dann ist es statistisch nicht sinnvoll, den Durchschnitt der Befragtengruppe auch für die gesamte Gesellschaft anzunehmen. Die Befragungsdaten laufen so durch verschiedene Gewichtungsmodelle, um am Ende eine Prognose zu formulieren, die den Trend der Wahl akkurat darstellen kann.
Wenn im Laufe des Abends und der Nacht dann die ersten Stimmbezirke ausgezählt werden, können Hochrechnungen veröffentlicht werden. Die beziehen sich dann auf die tatsächlichen Auszählungen aus zufällig ausgewählten Stimmbezirken und werden im Laufe des Abends immer konkreter. Sobald alle Schnellmeldungen bei der Landeswahlleiterin eingegangen sind, werden die Ergebnisse auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Dort sind auch die Internetauftritte der einzelnen Kommunen und Städte verlinkt.
Wie kann man sich vor Desinformation zu Wahlen schützen?
Immer, und ganz besonders bei Wahlen, gilt also: Lieber einmal zu oft innehalten, bevor man eine reißerische Information glaubt oder gar teilt. Häufig bringt eine gezielte Online-Suche bei seriösen Quellen bereits Klarheit. Wenn es um zweifelhafte Bilder geht, kann eine Bilder-Rückwärtssuche Aufschluss bringen.
Vorsicht ist aber bei Chatbots geboten: Ein Experiment von CORRECTIV.Faktencheck im Frühling 2024 zeigte, dass diese bei Fragen nach der Europawahl versagen. Die Bots erfanden Kandidatinnen und Kandidaten, wussten nicht, wann die Wahl stattfindet und empfahlen erfundene oder zweifelhafte Quellen. Weitere Tipps rund ums Faktenchecken haben wir hier gesammelt.
Redigatur: Steffen Kutzner, Sophie Timmermann

Gib den ersten Kommentar ab